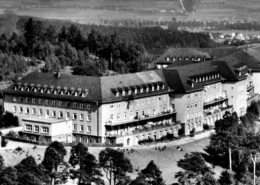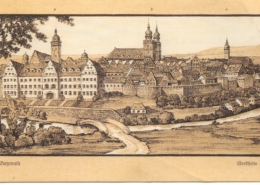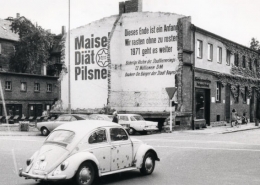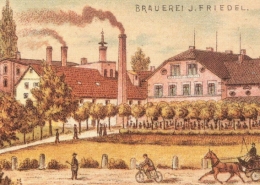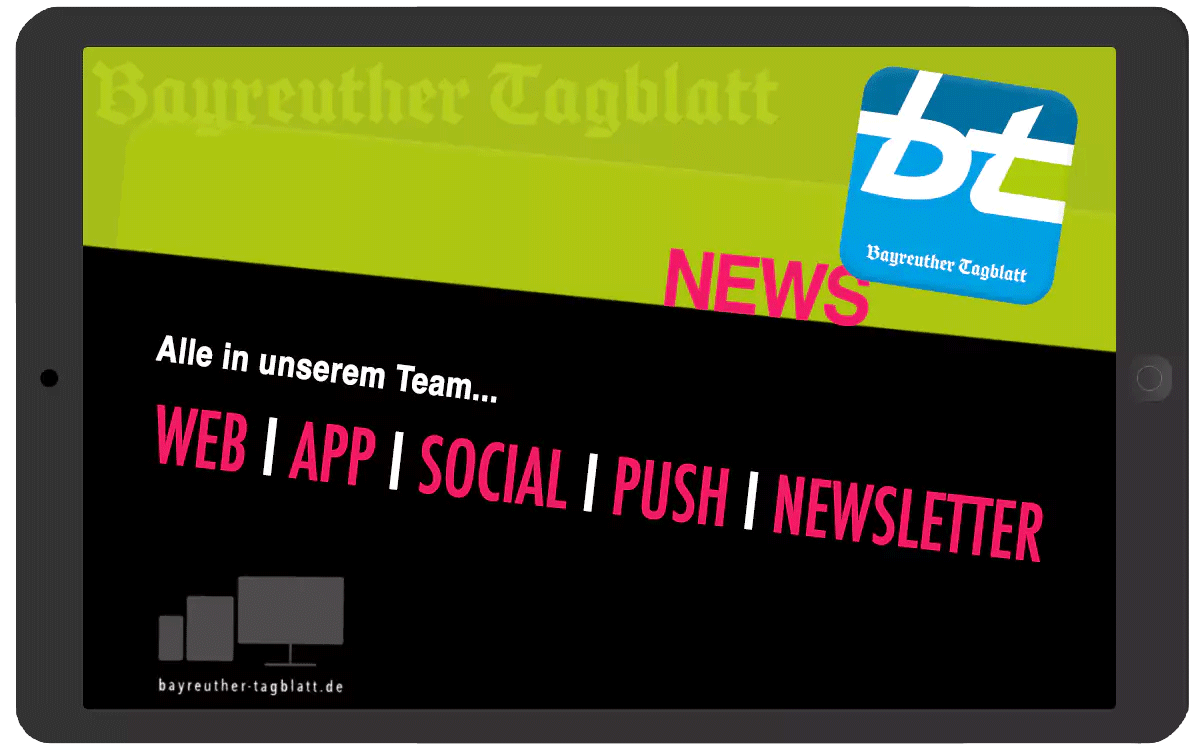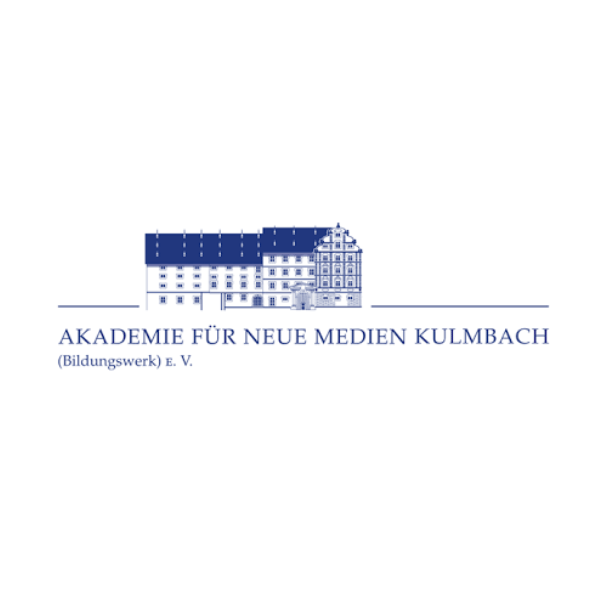Zuletzt aktualisiert am
Magazin/Historisch-Stadtteile
Schloss Colmdorf und die Rollwenzelei
Woher kommen eigentlich die siedlungsgeschichtlichen Namen unserer Bayreuther Ortsteile? In Teil sechs der Stadtteil-Serie blickt bt-Hobbyhistoriker Stephan Müller auf Colmdorf.
Seit 1. April 1939 ist Colmdorf ein Stadtteil von Bayreuth. Im Landbuch von 1398 wird der Ortsname noch “Kolbendorf” geschrieben, so dass für die Historiker keine Zweifel bestehen, dass das Dorf nach der großen Sippe der Kolb benannt wurde, die aus einem Urhof in Unterwaiz stammen.
Auf einem herrschaftlichen Lehenhof in Kolbendorf saß noch ein möglicherweise niederadliger Lehenmann namens Schleicher. Im Landbuch befindet sich ein Hinweis, dass der Wirtschaftshof mit dem “Hals(gericht) und ander Gericht gen Beyerreut” gehört.
Später kaufte ein Herr vom Imhoff von Altentrebgast das herrschaftliche Lehen. Als die Familie Imhoff ausstarb, fiel das Erbe an den Landesherrn. Markgraf Christian schenkte das Lehen 1603 seinen Kanzler Friedrich Huldirch von Varell, der ich von Berlin nach in seine neue Residenz begleitet hat. Bayreuth hat Varell möglicherweise zu verdanken, dass die Residenz der Markgrafschaft Bayreuth-Kulmbach von der Plassenburg in Kulmbach nach Bayreuth verlegt wurde.
Colmdorfer Schloss
Seine heutige Form verdankt das Colmdorfer Schloss aber Freiherr von Reitzenstein, der das Grundstück 1754 erwarb und das noch heute bestehende Colmdorfer Schloss bauen ließ.

Schloss im Bayreuther Stadtteil Colmdorf. Foto: Stephan Müller
Die Markgräfin Wilhelmine starb im Jahr 1758. Nur ein Jahr nach ihrem Tod kaufte Markgraf Friedrich das Anwesen für seine zweite Gemahlin. Er hatte Wilhelmines Nichte (!) Sophie Caroline Marie von Braunschweig-Wolfenbüttel geheiratet und ließ 1760 das Schloss mit zwei Seitenflügeln vergrößern. Sophie Caroline Marie nannte ihr Schlösschen “Carolinenruhe”.
Rollwenzelei nahe Colmdorf
Nur wenige Schritte von Colmdorf entfernt befindet sich die Rollwenzelei. Jeder Bayreuther weiß, dass der Schriftsteller Jean Paul ab 1809 häufig mit Stock und Umhängetasche zur Rollwenzelei wanderte. Fast jeden Tag packte er seine “Siebensachen” zusammen, verstaute Hefte, Bücher, Bogen und Papier in seinen Ranzen und wanderte aus der Stadt über die Königsallee in Richtung Eremitage.
Bei Frau Dorothea Rollwenzel bekamen Jean Paul und sein Hund eine deftige Brotzeit. In dem kleinen Studierzimmer im ersten Stock fand er die Muße, die er zum Schreiben brauchte. Die selbstgebraute Tinte durfte ebenso nicht fehlen, wie auch eine Flasche Wein, die “Tinte für den Geist”.
Das frühere „Chaussee- und Zollhaus“ war Zahlstelle für die Benutzung der ursprünglich nur für Herrschaften und Kutschen erbauten Königsallee, die den allgemeinen Verkehr erst 1792 übergeben wurde.

In der Rollwenzelei befindet sich das Dichterstübchen von Jean Paul. Archiv: Bernd Mayer
Zu einer Schankwirtschaft entwickelte sich die Rollwenzelei erst in der Franzosenzeit (1806 bis 1810). Die Wirtin soll damals einen französischen Soldaten, der sich die Beine erfroren hatte, gut gepflegt haben. Zum Dank habe sie dafür die Konzession zur Errichtung einer Wirtschaft erhalten. Heute kann man in der Rollwenzelei das Dichterstübchen von Jean Paul besichtigen.
Stephan Müller
Stephan Müller (54) ist Stadtrat, Hobbyhistoriker, freiberuflicher Journalist und Autor zahlreicher Bücher zur Geschichte Bayreuths. Für das Bayreuther Tagblatt hat er sein Archiv geöffnet. Die besten Anekdoten gibt es immer wieder hier beim bt.