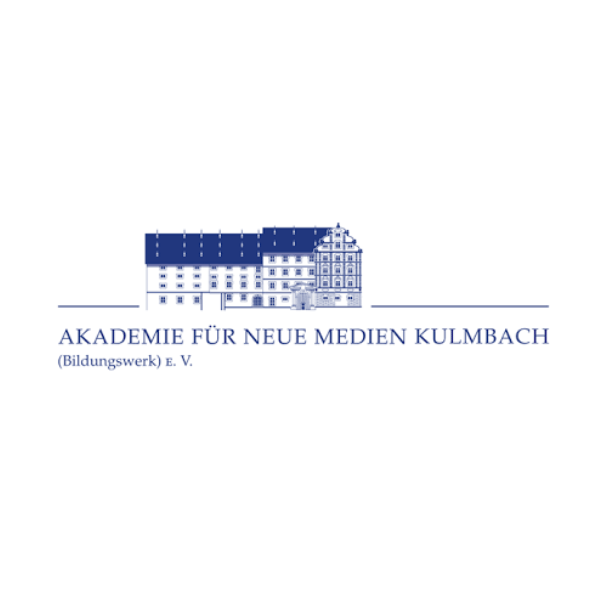Zuletzt aktualisiert am
Essen und Trinken
Wirtsgogl-G’schichtla: Vom Schnaps und Christbaumschauen
Adrian Roßner ist einer der jüngsten Heimatforscher Deutschlands und kommt aus der Region
Adrian Roßner ist einer der jüngsten Heimatforscher Deutschlands und kommt aus der Region: In unserer bt-Serie „Wirtsgogl-Gschichtla“ gibt er regelmäßig Einblicke ins seinen Fundus: kuriose Geschichten, unglaubliche Erzählungen und Besonderheiten aus unserer Region.
Hier die aktuellste Geschichte des Wirtsgogl als Text und als Podcast zum Anhören.
Wirtsgogl G’schichtla #15 als Podcast zum Anhören
Christbaumloben
„Ach Godderla, iss des a scheener Baam!“ „Willst aweng an Schnaps?“ Derlei Unterhaltungen hat der Autor dieser Zeilen insbesondere in den Tagen nach Heiligabend immer häufiger gehört, nachdem sich das „Christbaumschauen“ (oder auch „Christbaumloben“) wieder wachsender Beliebtheit erfreut. Der Kern dieses modernen Brauches ist relativ schnell zusammengefasst: Gegen ein ehrliches Lob (wobei „ehrlich“ hier sehr weit ausgelegt werden darf) des geschmückten Baums, bekommt der Gast vom Hausherrn einen Schnaps serviert.

Symbolfoto: Pixabay
Christbäume gibt es schon seit dem 16. Jahrhundert
Wann genau mit diesem Ritus begonnen worden ist, lässt sich aufgrund fehlender Quellen leider nicht belegen, doch taucht der erste „Christbaum“ tatsächlich schon im 16. Jahrhundert auf, als in einer Akte bezüglich des Hübnerwaldes bei Stockstadt am Main die Sprache auf „die weiennacht baum“ kommt. Diese Nennung von 1527 bringt sie erstmals direkt mit dem Weihnachtsfest in Verbindung, nachdem man Bäume bereits vorher im Rahmen sogenannter „Paradiesspiele“ immer wieder im Gottesdienst eingesetzt hatte. Damals allerdings standen sie stellvertretend für den Baum der Erkenntnis, von dem Adam und Eva den Apfel pflückten und damit die Erbsünde auf das Menschengeschlecht brachten. In Erinnerung an den Sündenfall nebst anschließender Buße durch Christus, wurde die biblische Episode am 24. Dezember inszeniert.
In den höchsten Tönen loben
In privaten Räumen findet sich der Christbaum erst ab dem 17. Jahrhundert: Damals sah der Brauch es vor, die grüne Tanne mit Süßigkeiten und kleinen Spielsachen zu behängen, die die Kinder anschließend herunterangeln oder auch -schütteln durften. Vermutlich steckt darin – also im kindlichen Spiel – auch die hauptsächliche Bedeutung des Baums, den man ab dem 19. Jahrhundert mit Kerzen, Äpfeln und ersten gläsernen Figürchen behing. Zur größten Enttäuschung des berühmten Großvaters Hoppenstedt, war das Schmücken des Baums mit Lametta in Oberfranken noch nie weit verbreitet – hier blieb er in den meisten Fällen tatsächlich „grün und umweltfreundlich“, was jedoch nicht daran hindert, ihn in der Zeit nach Heiligabend in den höchsten Tönen zu loben. Während man einst auch zu Fremden gehen konnte, um die Tanne zu bestaunen, was in erster Linie zum Aufbau einer dörflichen Gemeinschaft beitragen sollte, zieht man nun meist in befreundeten Grüppchen umher, um die Bäume nebst Dekoration zu lobpreisen.

Foto: red
In manchen Ortschaften hat sich daraus ein richtiggehender „Sport“ entwickelt, der am Ende des Umzugs die Prämierung des „schennsten Baams“ vorsieht. Welcher Hintergedanke nun auch tatsächlich in diesem Brauch verborgen liegen mag, geht es doch in erster Linie darum, die Feiertage dazu zu nutzen, sich mit Verwandten und Freunden zu umgeben, ehe nach Silvester das neue – sicher wieder arbeitsreiche – Jahr beginnt.
Zwölf Raunächte
Apropos neues Jahr: Den Übergang vom Alten zum Neuen symboliserten einst die zwölf Raunächte – auch die Öbersten genannt – vom 24. Dezember bis zum 6. Januar. In jener Zeit, so war man überzeugt, würden Geister, Hexen und Dämonen es besonders schlimm auf der Erde treiben, weswegen es für jene „Raunächte“ eine Unzahl an Bräuchen gibt. Schon in ihrem Namen selbst, der sich vermutlich vom Ausräuchern der Häuser mit reinigenden Kräutern ableiten lässt, findet sich ein erstes Beispiel.
Auf der anderen Seite jedoch darf man keine Schleißen verbrennen, da jedes Feld, über das der Rauch zöge, verdorren würde. Genauso war es verboten, nach 7 Uhr noch zu arbeiten, da man ansonsten im gesamten nächsten Jahr niemals rechtzeitig Feierabend würde machen können. Ein Furunkel bekommt zudem derjenige am Hintern, der es wagte, sich auf den Tisch oder auf Rainsteine zu setzen. Vor allem für Frauen war es außerdem wichtig, weder zu stricken, noch zu flicken, da ihnen andernfalls die Gewitter nachzogen.
Stärke antrinken
Besonders bedeutend waren die drei Nächte vom 24. auf den 25. Dezember, die Silvesternacht und die letzte vom 5. auf den 6. Januar, der deshalb auch bis heute als „Öberster“ bezeichnet wird. An jenem Tag galt es, sich die Stärke für das neue Jahr anzutrinken, wobei – wichtig zu wissen – meist die Frauen den Männern das Bier zahlten. Insbesondere das frische Bockbier erfreute sich damals einer großen Beliebtheit und versprach den Männern die Stärke, den Frauen die Schönheit, so sie nur genug davon tranken.
Nach einer letzten Räucherung des Hauses wurde am Abend des 6. damit begonnen, den Christbaum abzuschmücken, womit zugleich auch die Raunächte ihr Ende fanden. Die dunkle Zeit lag damit hinter den Menschen und man fieberte auf den Beginn des eigentlichen Arbeitsjahres hin, der schließlich an Lichtmess gefeiert worden ist.
Redaktion