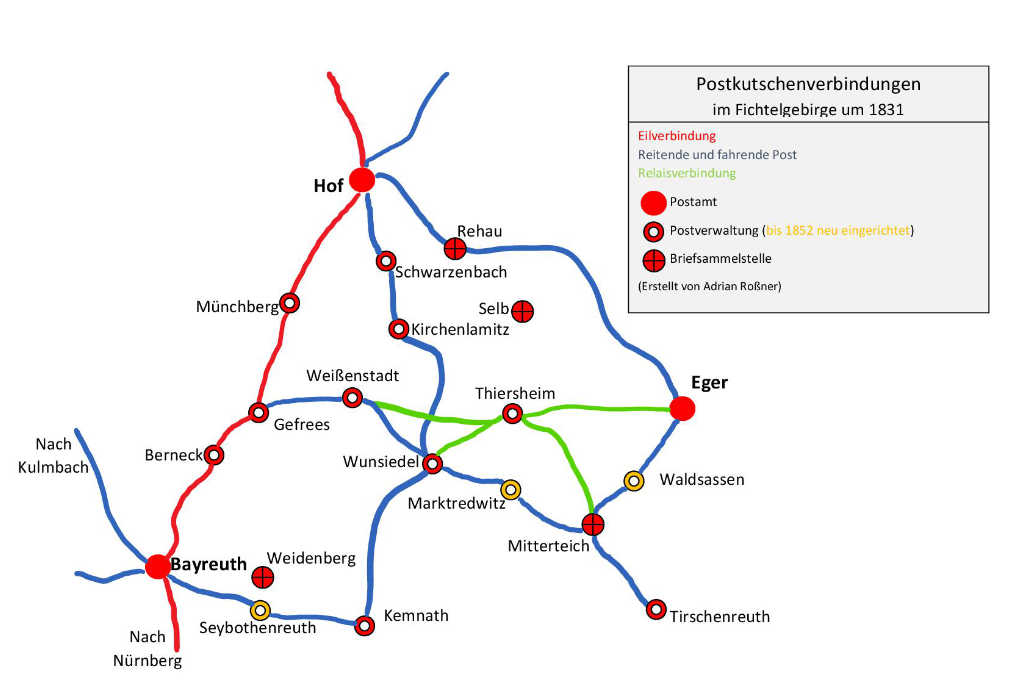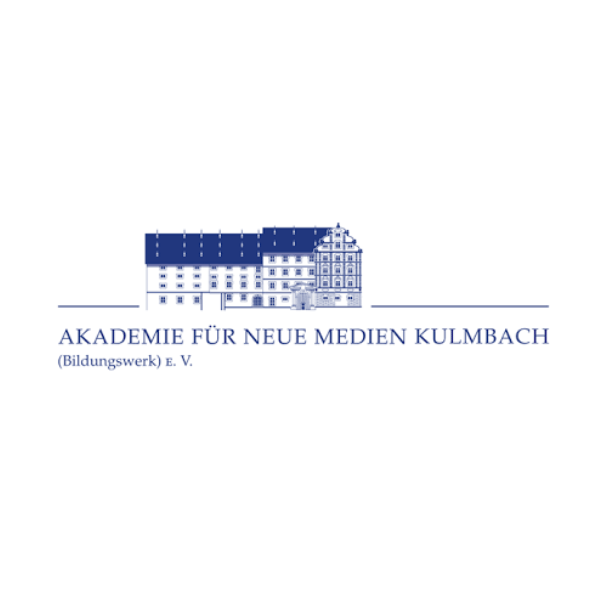Walter Demel: Bayreuths Bester neben Richard Wagner
Passend zur nordischen Ski-WM in Seefeld hat der Bayreuther Hobbyhistoriker eine Geschichte über Walter Demel ausgegraben. Bayreuths wohl besten Langläufer aller Zeiten. Und der einzige Bayreuther, der es neben Richard Wagner in die Auswahl zur ZDF-Sendung “Unsere Besten” geschafft hat.
Hier ist die Geschichte:
Walter Demel aber ist ein ganz Großer in der gesamten Geschichte des deutschen Skilanglaufs. In einer Epoche, in der diese Sportart fast ausschließlich von den Skandinaviern und den stets mehr oder weniger dopingverdächtigen Osteuropäern geprägt wurde, gewann er die Bronzemedaille über 30 Kilometer bei den Weltmeisterschaften 1966 am Holmenkollen in Oslo.
Als 40-Jähriger zu Olympia
Er siegte als erster Nicht-Skandinavier im schwedischen Kiruna über 15 und 30 Kilometer. Er war mit 40 Meistertiteln jahrzehntelang deutscher Rekordhalter im Skilanglauf, bis ihn der heutige Bundestrainer Jochen Behle mit 42 übertraf. Und: Er nahm an vier Olympischen Winterspielen teil. Nach Innsbruck (1964), Grenoble (1968) und als deutscher Fahnenträger in Sapporo (1972) ging er auch 1976 in Innsbruck als 40-Jähriger noch einmal an den Start.
Sein stärkstes Jahr hatte Demel 1972, als er in Sapporo über die mörderische Strecke von 50 Kilometer als Fünfter nur 32 Sekunden an der Bronzemedaille vorbei schrammte. Auch über 30 Kilometer wurde er Fünfter und über 15 Kilometer zwischen den „Sprintern“ hervorragender Siebter.
Fünf Bayreuther bei Olympia
Das stärkste Jahr für den Bayreuther Sport insgesamt, war aber vier Jahre zuvor: das Olympiajahr 1968. Mit Walter Demel, den Skispringern Henrik Ohlmeyer (Bischofsgrün) und dem Warmensteinacher Günter Göllner (1. FC Bayreuth), dem Fechter Walter Köstner und der Schwimmerin Heidemarie Reineck waren gleich fünf Athleten aus der Bayreuther Region bei den Spielen in Grenoble und Mexico City dabei.
40, 40, 40
Demel (Jahrgang 1935) landete selbst als 40-Jähriger über 50 Kilometer nur zwei Plätze hinter dem damals besten bundesdeutschen Langläufer, Georg Zipfel aus Kirchzarten. Im 30-Kilometer-Lauf schien sich der Senior schließlich mit einem Jubiläum der besonderen Art einen Spaß zu machen: Der 40-jährige 40-fache deutsche Meister belegte Platz 40.
Für die SPD in den Stadtrat
Demel stand aber nicht nur in sportlicher Hinsicht, sondern auch als Kommunalpolitiker im Rampenlicht. Insgesamt war er von 1966 bis 2008 unglaubliche 42 Jahre für die SPD im Bayreuther Stadtrat vertreten. Im Mai 1966 war der 30-jährige BGS-Beamte als jüngster Kandidat in den Bayreuther Stadtrat eingezogen. Bei seiner Vereidigung in der Stadthalle herrschte ein riesiger Medienrummel. Ein Fernsehteam aus Schweden und sogar Journalisten aus der DDR waren gekommen um aus Bayreuth zu berichten.
Sie kamen aber nicht wegen Walter Demel. Auch wenn der Skilangläufer als Olympia-Zehnter von 1964 und frisch gebackener WM-Bronzemedaillengewinner von Kandidaten-Platz 23 unter die “Top Ten” der SPD-Liste gerückt ist, wurde er von den ausländischen Journalistenteams nicht weiter beachtet.
Als die NPD den Einzug schaffte
Im Mittelpunkt standen nämlich drei NPD-Stadträte, die mit einem unerwartet guten Ergebnis von 8,4 Prozent neben der SPD, der CSU und der Bayreuther Gemeinschaft in den Bayreuther Stadtrat eingezogen sind. Auch wegen der satten 14 Prozent, die die NPD bei der Landtagswahl im selben Jahr erreichen konnte, war die Befürchtung eines “braunen Bayreuth” im Ausland ein großes Thema. Der Spuk sollte aber schnell vorbei sein. Nach den Erfolgen der sozialliberalen Koalition in Bonn und dem wirtschaftlichen Aufschwung ließen die Erfolge der NPD, die damals in zahlreichen Landtagen und Gemeinderäten vertreten waren, nach. Die NPD wurde auch in Bayreuth zur Splitterpartei und zog nie mehr in den Bayreuther Stadtrat ein.
Der Sport hat sich für den Kommerz entschieden.
(Walter Demel)
„Der Sport hat sich für den Kommerz entschieden“, resümiert der gelernte Dachdecker inzwischen nachdenklich und etwas wehmütig, wobei er keinesfalls Neid über die Verdienstmöglichkeiten der modernen Zeit empfindet. „Bei uns stand wahrscheinlich viel mehr die Freude am Langlauf im Vordergrund.“
Walter Demel kam erst mit 21 Jahren als Beamter des Bundesgrenzschutzes zu dieser Sportart: „Die BGS-Skimannschaft hat noch interessierte Langläufer gesucht und ich habe mich halt gemeldet. Auf Alpinski bin ich damals schon etwas herumgerutscht, aber mit den schmalen Langlauflatten hat es mich am Anfang oft auf den Hintern gesetzt.“
Ganz besonders gerne denke ich an den Holmenkollen zurück. Aber nicht nur, weil ich dort meinen größten sportliche Erfolg hatte. Einmal musste ich über 50 Kilometer aufgeben. Ich kam aber nicht früher, sondern wesentlich später ins Quartier zurück. Einige Norweger holten mich an ihr Lagerfeuer – und was die mir damals eingeflößt haben war mit Sicherheit kein Kamillentee.
(Walter Demel)
Text und Fotos: Stephan Müller
Stephan Müller (53) ist Stadtrat, Hobbyhistoriker, freiberuflicher Journalist und Autor zahlreicher Bücher zur Geschichte Bayreuths. Für das Bayreuther Tagblatt hat er sein Archiv geöffnet. Die besten Anekdoten gibt es künftig hier beim bt. Darunter Geschichten wie die von Bayreuths Langlauf-Legende Walter Demel, die bisher in keinem Buch veröffentlicht wurden.